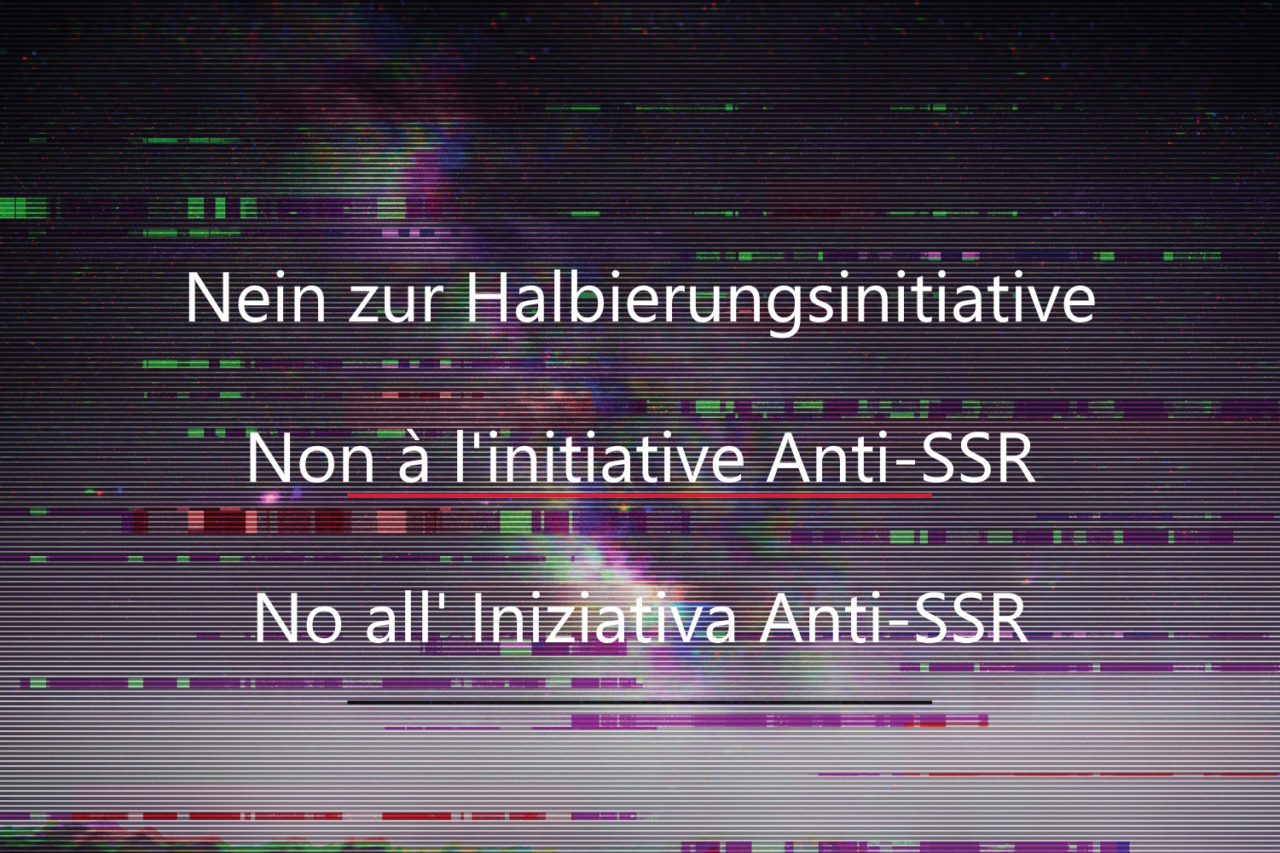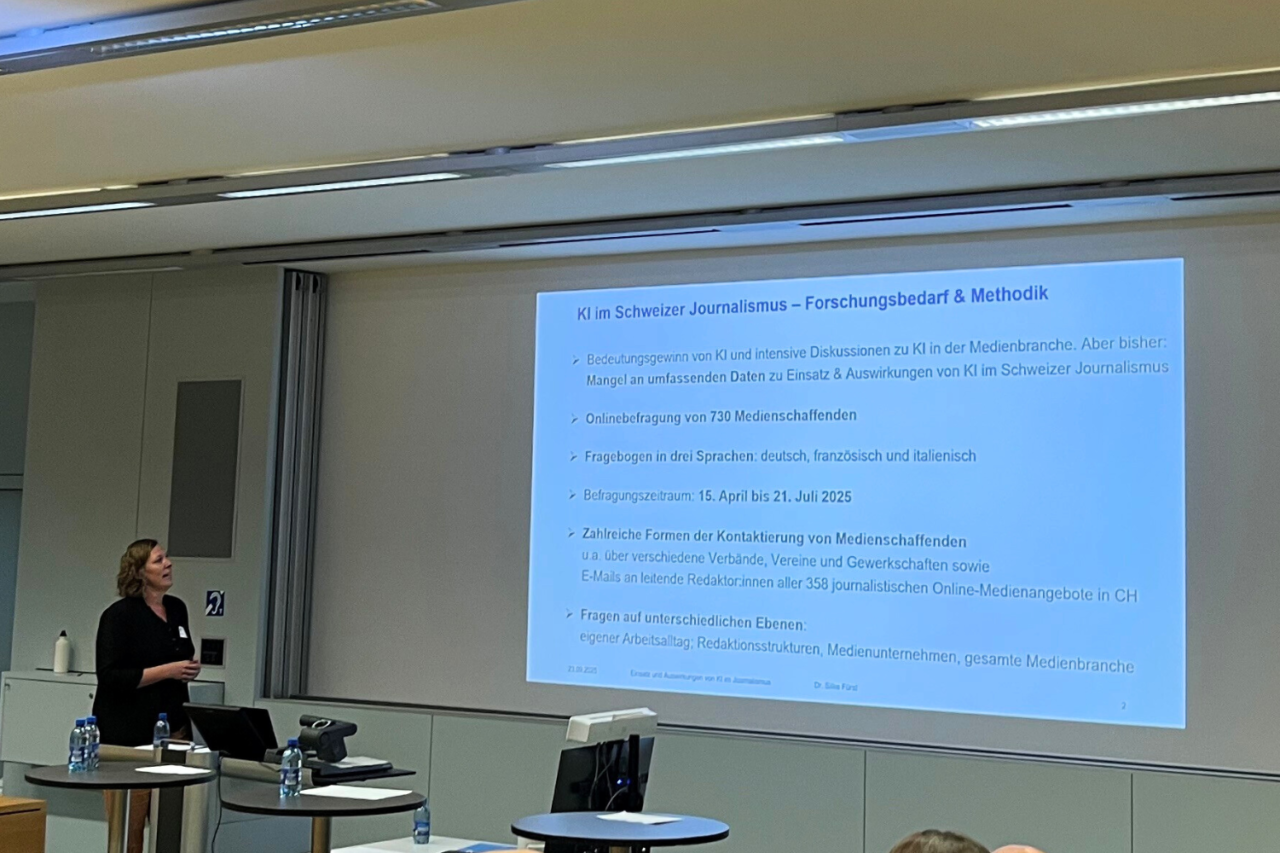
Künstliche Intelligenz ist eine der prägendsten Entwicklungen unserer Zeit - auch im Journalismus. Sie kann helfen, Qualität und Effizienz zu steigern, birgt aber ebenso Risiken wie den Verlust von Arbeitsplätzen oder sinkendes Vertrauen in Medien. Das fög hat nun erstmals über 700 Medienschaffende in drei Sprachregionen der Schweiz befragt und stellt fest: KI-Tools haben sich in den Redaktionen etabliert.
Für die Mehrheit der Medienschaffenden (87%) ist KI im Alltag angekommen und wird als nützlich für die eigene Arbeit empfunden (63%). Allerdings werden diese Tools dann vor allem unterstützend genutzt; also beispielsweise bei Transkriptionen und nicht für die Erstellung ganzer Inhalte. So ist es wenig überraschend, dass vier von fünf Medienschaffenden der Meinung sind, dass KI im Journalismus viele ethische Fragen aufwirft. So gehen viele auch davon aus, dass KI die Verbreitung von Falschinformationen begünstigt und nicht zuletzt das Vertrauen des Publikums gefährden könnte.
Mit Sorge blickt das SSM auf die Aussagen, dass wenigen Medienschaffenden keine Zeit bliebe KI-generierte Informationen zu überprüfen oder mit eigenen Quellen zu ergänzen. Auch bedenklich ist, dass es in den Redaktionen keine systematischen Massnahmen der Qualitätssicherung gäbe oder diese den befragten Medienschaffenden nicht bekannt wären. Obwohl solche KI-Richtlinien in vielen Medienhäusern und auch branchenweit eingeführt wurden sind sie vielen Medienschaffenden offensichtlich nicht bekannt.
Mehr als 80% der Medienschaffenden hält branchenweite Standards zur Kennzeichnung von KI in der Medienberichterstattung für notwendig. So könne auch das Publikum den Einsatz von KI besser nachvollziehen.
Mit dem KI-Einsatz grosser Tech-Unternehmen stellen sich nicht nur Fragen der inhaltlichen Abhängigkeit sondern auch nach den Kosten. Die befragten Medienschaffenden sprechen sich für die Kooperation und Investition in eigene KI-Tools aus. Damit könnten die Investitionskosten für die einzelnen Medienunternehmen reduziert werden. Ausserdem kann die lokale Medienproduktion besser berücksichtigt und das Ungleichgewicht zwischen kleinen und grossen Redaktionen verringert werden.
Wie die Befragten anerkennt auch das SSM, dass die Schweizer Medienbranche moderne Technologien unter einheitlichen und bekannten Richtlinien beiziehen soll. Die dadurch freien Ressourcen sollen aber nicht in Tech-Unternehmen sondern in Arbeitskräfte in den Redaktionen investiert werden. Denn hinter Informationen müssen Menschen stehen, die diese prüfen und mit hoher Qualität auch das Vertrauen des Publikums erhalten.
Die Studie zu den Einschätzungen von Schweizer Medienschaffenden zum Einsatz von KI im Journalismus ist auf www.foeg.uzh.ch erhältlich.